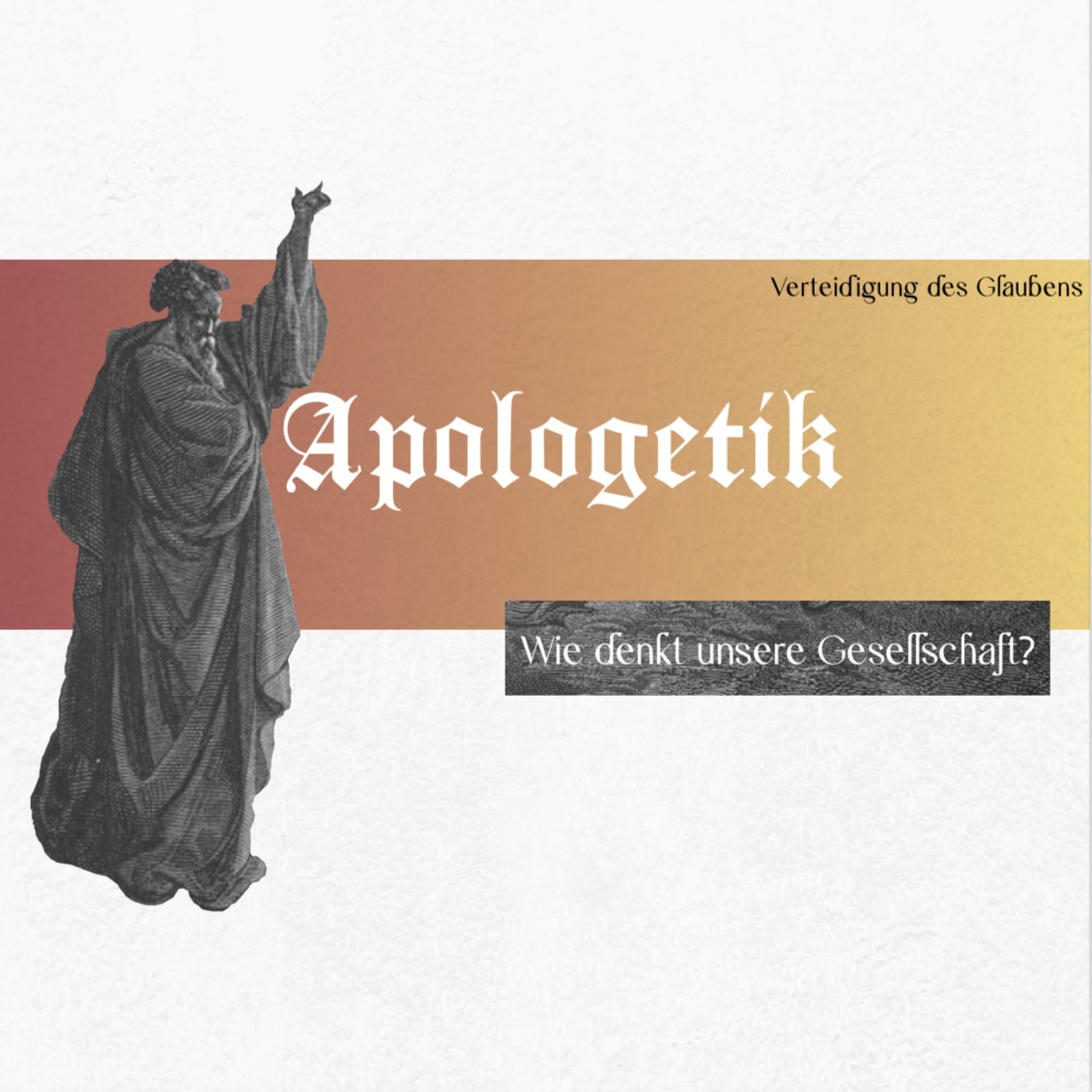Wie denkt unsere Gesellschaft?
Die Grundlage für die Verteidigung des Glaubens in der Praxis bietet uns das Wort Gottes selbst. Und das gleich an mehreren Stellen: „Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus! Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt!“ (Kol. 4,5-6).
Paulus als Vorbild
Am Beispiel des Apostel Paulus in Athen sehen wir klar, wie hilfreich es in der Verkündigung und Verteidigung des Evangeliums sein kann, die Gesellschaft zu kennen, der man predigt. Zu einer Gesellschaft gehören einige wichtige Charakteristiken, also Eigenschaften, die sie besonders auszeichnen und ihr eine gewisse Persönlichkeit verleihen. Dazu gehören unter anderem: ihre Kultur, Weltanschauung und Gottesvorstellung.
Lasst uns nun davon ausgehend am Vorbild von Paulus einige Prinzipien der Verkündigung und Verteidigung des Evangeliums ableiten, an die wir uns auch heute halten können und sollen (v.a. Apg. 17 & Kol. 4).
Paulus zitiert einen griechischen Poeten, wahrscheinlich Arates aus Zilizien (der Heimat des Paulus) oder den stoischen Philosophen Kleanthes, als er zu den Athenern auf dem Areopag spricht: „Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: Denn wir sind auch sein Geschlecht.“ (Apg. 17,28). Vorher berichtet Paulus nüchtern über die Beobachtungen, die er an den Athenern vollzogen hat: „Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: Einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.“ (Apostelgeschichte 17,23). Was tut er also? Paulus sucht gemeinsamen Grund, um von dort aus die Botschaft des Evangeliums in die gespitzten Ohren erschallen zu lassen. Wohlgemerkt tut er eines nicht: Den Inhalt des Evangeliums ändern; sondern er sucht vielmehr einen Weg, eine offene Tür, um den unabänderlichen, zeitlos gleichen Inhalt der Frohen Botschaft an die verschiedensten Völker, Sprachen und Nationen kundzutun: „Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Danksagung; und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll.“ (Kol. 4,2-4)
Der Zeitgeist unserer Epoche
Die brennende Frage wäre demnach, was unser Land, Deutschland, oder den Westen in seiner Allgemeinheit, jetzt gerade auszeichnet.
Lasst uns dazu auf ein gewichtiges Merkmal eingehen: Die Philosophie des Postmodernismus.
Sie ist in dem Sinne keine philosophische Lehre, wie man sie kennt. Zum Beispiel war zu der Zeit des Paulus und der Athener die Philosophie des Stoizismus (griech. Philosophenschule, die den Menschen durch Gebrauch von Vernunft, Tugend und Rationalität von seinen Lüsten und Trieben sowie äußeren Schicksalen
zu befreien suchte) oder Epikureismus (griech. Philosophenschule, die den Lebenssinn im Genuss des Materiellen sieht) weit verbreitet (vgl. Apg. 17,18). Sie ist so gesehen vielmehr eine mögliche Beschreibung des Zeitgeistes unserer Epoche.
Was zeichnet sie aus? Hier begegnen wir der Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Wir sind bereits so sehr von postmodernem Denken umgeben und wahrscheinlich auch geprägt, dass wir praktisch darin baden. Im Prinzip ist der Postmodernismus eine radikale Art von Relativismus. Das bedeutet, dass er sowohl absolute Wahrheit, Bedeutung als auch Interpretation verneint. Es ist also eine Art totaler Relativismus. Das heißt, dass Erkenntnisse nie allgemeingültig richtig sind, sondern jeweils nur vom Standpunkt des Betrachtenden aus. Vergleichbar wäre der Postmodernismus auch mit einer Art Subjektivismus: Hierbei sind alle Erkenntnisse Schöpfungen des individuellen Bewusstseins einer Person, also nicht allgemeingültig.
Wenn du jemanden sagen hörst: „Du hast deine Wahrheit und ich meine, und damit ist gut.“, dann trifft die Theorie die Praxis.
Nichtsdestotrotz zählen wir einige prominente postmoderne Verneinungen auf:
- Keine absolute & objektive Wahrheit
- Keine absolute Bedeutung oder Sinn
- Keine absolute Geschichte oder Vergangenheit
- Keine absolute Interpretation
- Kein absoluter Zweck oder Bestimmung
- Kein absolutes Richtig oder Falsch (moralischer Relativismus)
Zur Wahrheit stehen
Ein einsichtiges Beispiel ist der Umgang mit dem Thema Abtreibung. Kaum jemand wagt es sich in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder unter Nachbarn, dazu in lebensbejahender Haltung zu positionieren. Warum? Man könne doch nicht ein so individuelles Geschick beurteilen, oder es prinzipiell als moralisch schlecht, falsch oder verwerflich aburteilen, heißt es dann. Alles ist Ansichtssache, nicht wahr? Spürst du, wie voll die Badewanne bereits mit postmodernem Badewasser ist? Tendenz des Pegels: steigend! Die Bibel hingegen erhebt absoluten Wahrheitsanspruch und Jesus Christus, der Sohn Gottes, Exklusivität in Bezug auf die Errettung: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ (Joh. 14,6). Konträrer als diese beiden Positionen könnte man sich nicht gegenüberstehen, oder? Wie begegnet man also einer Gesellschaft wie dieser? Man verkündigt ihr das heilende und heilbringende Wort des Evangeliums, und geht wohlwollend und sanftmütig auf ihre Fragen ein (vgl. 1.Petr. 3,15-16):
„Ich bin der wahre Weinstock…“ (Joh. 15,1) sagt Jesus; „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten;…“ (Joh. 16,13).
Auf dieses Wort dürfen wir als Kinder Gottes, die mit seinem Geist versiegelt sind, vertrauen, wenn wir mit anderen Menschen reden. Wir tragen die Wahrheit in persona in uns. Preis dem Herrn dafür!
Die Existenzfrage des christlichen Glaubens
„Was gilt es zu verteidigen?“, könnte man nun fragen.
Das alles entscheidende Ereignis der Geschichte in Bezug auf die Errettung ist die Frage: „Ist Jesus von den Toten auferstanden?“ Paulus schreibt mit großen Buchstaben um die Dramatik dieses Themas, als um die Existenzfrage des christlichen Glaubens überhaupt:
„Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen.“ (1.Kor. 15,16-18)
Hier können wir überzeugende Argumente anführen:
Erstens: die frühen Berichte als vertrauenswürdige Zeugnisse der Geschichte (NT-Briefe als historisch glaubwürdige Quellen).
Zweitens: die einstimmigen Zeugnisse über das leere Grab – der Leib Jesu fehlt.
Drittens: die Berichte der Augenzeugen (laut NT mehr als 515 Menschen, denen Jesus nach der Auferstehung begegnete).
Viertens: Die Entstehung der Gemeinde innerhalb kürzester Zeit und das aus einer Gruppe ängstlicher Jünger, die sich hinter verschlossenen Türen versteckten? (vgl. Joh. 20,19). Da muss etwas Weltbewegendes, Dramatisches geschehen sein – die Auferstehung!
„Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.“ (Röm. 10,8b-9)