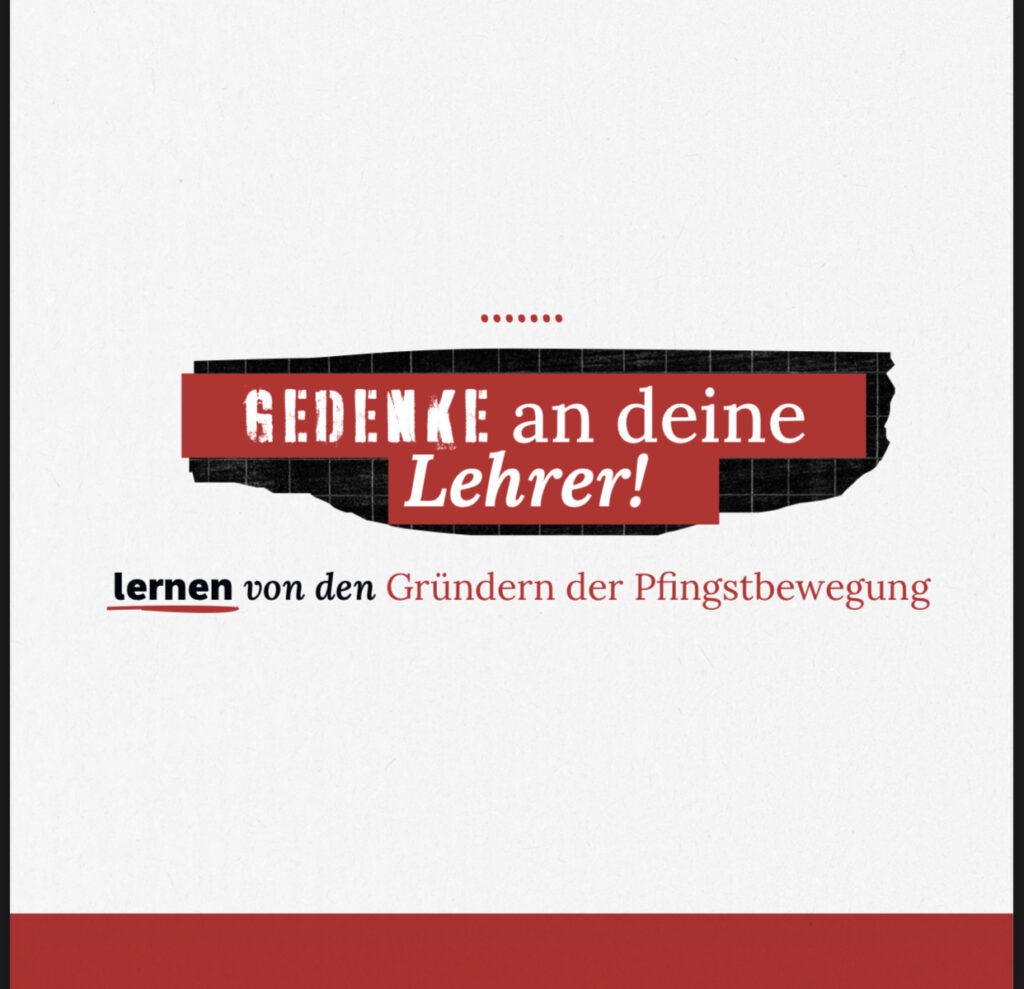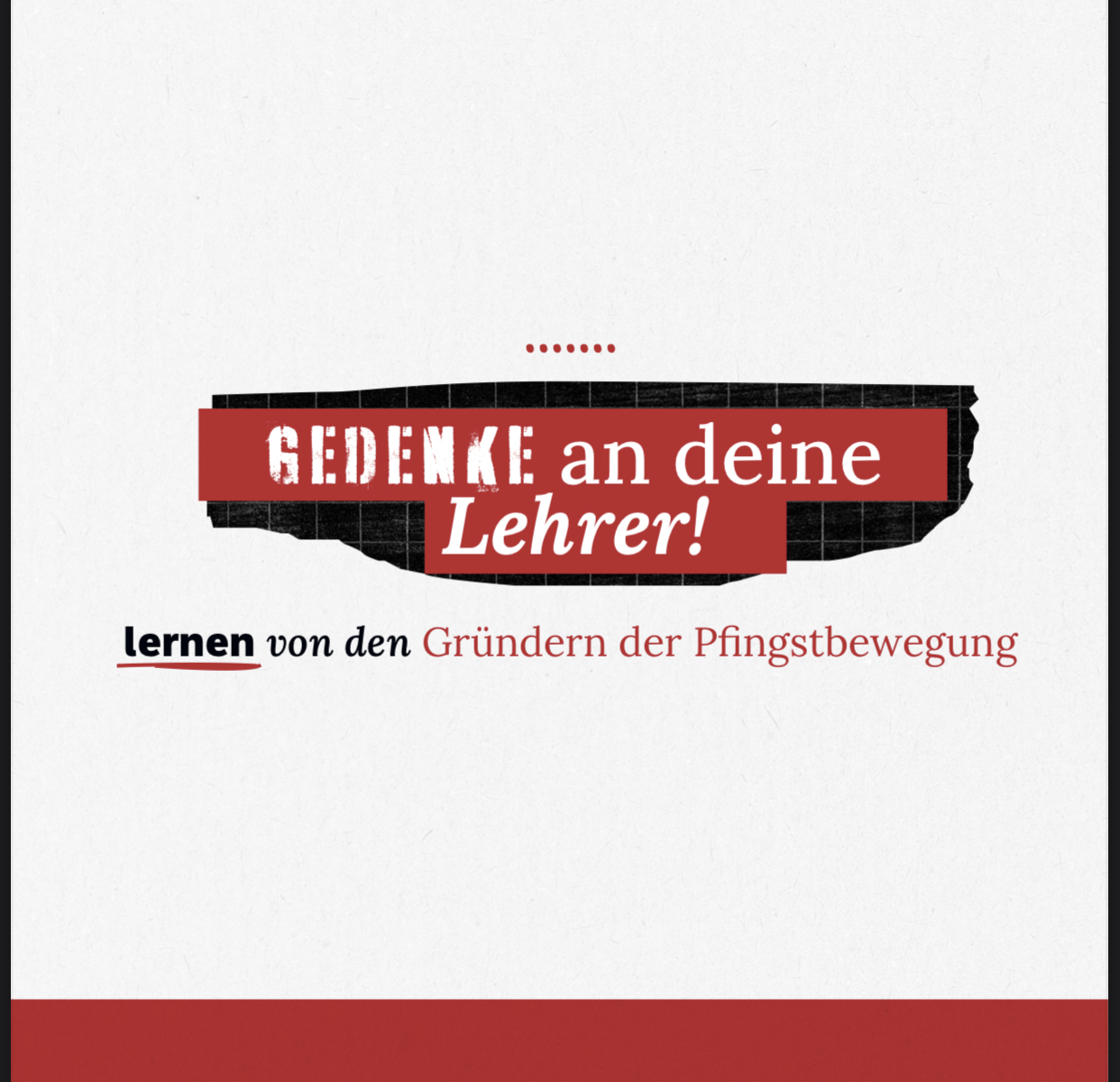„Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach.“ (Hebr. 13,7)
Für mich persönlich ist es immer wieder besonders wertvoll, Biografien von Männern und Frauen Gottes zu studieren. Diese Lebensgeschichten ermutigen uns in der Nachfolge Jesu. Von ihnen können wir so manche wichtige Wahrheit für unser geistliches Leben lernen.
Oftmals unterschätzen wir die Kraft dieser lebendigen Zeugnisse und setzen uns nur selten damit auseinander. Doch nicht selten haben diese wunderbaren Biografien Jünger Jesu in der Entscheidung, alles für ihren Herrn und Meister zu geben, entscheidend beeinflusst.
Wenn es darum geht, Personen zu nennen, durch die der Herr besonders wirkte, passiert es oft, dass Namen aus ferner Vergangenheit auftauchen. Vielleicht fallen Namen wie Martin Luther, Georg Müller oder John Wesley. Menschen, die aufgrund des großen Zeitabstandes oftmals für einen „unerreichbar“ scheinen und wo der Bezug nur schwer greifbar ist.
Aber wer weiß schon etwas über die Gründer unserer Pfingstbewegung? Namen wie Bidasch, Belych oder Levtschuk sind für die meisten Jugendlichen unbekannt. Mit dem Namen „Voronaev“ können noch einige etwas anfangen. Doch spätestens bei Schlagwörtern wie dem „Augustabkommen 1945“ und „Allunionsrat“ hört es bei der Mehrheit auf.
Dabei ist es nicht einmal 100 Jahre her, als diese Brüder für das Evangelium den Kampf unter schwierigsten Bedingungen austrugen. Ihnen und vielen anderen mutigen Gläubigen haben wir es zu verdanken, in dieser Erkenntnis in unseren Gemeinden Gott dienen zu dürfen.
Dieser Artikel soll das Leben der Gründer unserer Pfingstbewegung näher beleuchten. Es werden drei wertvolle geistliche Wahrheiten aufgezeigt, die wir für unser Leben anwenden können.
Lektion Nr. 1: Wir dürfen Großes von Gott erwarten
Es ist das Jahr 1920. Eine siebenköpfige Familie namens „Voronaev“ plant die Ausreise von Amerika, New York in die Ukraine. Auf den ersten Blick macht der Entschluss überhaupt keinen Sinn. Damals sowie heute ist New York eine Weltstadt. Wer es schaffte, dort eine Immobilie zu erwerben oder in Miete zu leben, war hoch angesehen. Es ist das Zentrum des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1920-er Jahre in Amerika. Dagegen kämpfen die Menschen in der Ukraine zur gleichen Zeit gegen Hunger und Armut. Die Folgen der Revolution und der Bürgerkrieg machten dem Land stark zu schaffen.
Wie also kommt es, dass die ehemals emigrierte Familie aus Russland wieder in die Ukraine möchte?
Der Anfang liegt in der Bekehrung eines gewissen Nikita Tscherkassow. Der junge, disziplinierte und ehrgeizige Mann hatte es sich fest vorgenommen, die Offiziersschule in Usbekistan, Taschkent, zu absolvieren. Doch seine Pläne werden unerwartet durchkreuzt. Durch Zufall besucht er eine baptistische Gemeinschaft und nimmt infolgedessen den christlichen Glauben an.
Aufgrund seines Glaubens kann er in der Armee nicht mehr dienen und flieht daraufhin unter einem gefälschten Pass mit dem Namen „Ivan Voronaev“. Die Flucht dauert mehr als vier Jahre. Über Aschabad, nach Baku, Omsk, China und schließlich nach Kobe, welches in Japan liegt, erstreckt sich die Jagd. Schließlich gelingt ihm im Jahr 1912 die Ausreise in die USA.
Während diesen vier turbulenten Jahren gründete Voronaev nicht nur seine eigene Familie, sondern gleich zwei neue Gemeinden.
Angekommen in Amerika beginnt er direkt mit einem dreijährigen Bibelstudium in Berkeley, San Francisco und wird 1917 Pastor in New York. Dort erlebt erst seine Tochter, dann seine Frau die Geistestaufe. Er selbst wird nach einem intensiven Bibelstudium als dritter der Familie mit dem Heiligen Geist getauft. In dieser Zeit spürt er klar und deutlich den Ruf, in die Ukraine zu gehen. Ein waghalsiger Schritt und ein mutiges Vorhaben. Doch Voronaev vertraut Gottes Stimme, Führung und Fürsorge und macht sich mit seiner gesamten Familie 1920 in Richtung Ukraine auf. Er hat eine ganz bestimmte Vision:
„Ganz Russland soll evangelisiert werden.“
In der Tat ein großes Ziel. Vielleicht würde mancher an dieser Stelle denken, dass es zu übertrieben wäre. Aber es passt zu Voronaev. Immer dort, wo er sich aufhielt, nutzte er die Möglichkeit, die er sah, um aktiv das Reich Gottes aufzubauen. Sei es bei den Gemeindegründungen in den Jahren, als er flüchten musste oder aber in der ruhigen Phase in Amerika, um sich tiefer mit Gottes Wort zu beschäftigen. Der Verlauf der weiteren Geschichte würde ihm recht geben, dass mit Gottes Hilfe schon bald das Ziel erreicht werden würde.
1921 startet Voronaev das Vorhaben nach Zwischenstationen in der Türkei und Bulgarien. Gott segnete das Werk gewaltig und schon fünf Jahre später entstanden 150 Gemeinden.
Weitere fünf Jahre vergingen und die Zahl der Gemeinden wuchs in der gesamten Sowjetunion auf 500 mit 25.000 Mitgliedern. Die Gottesdienste, die insbesondere Voronaev abhält, wurden mit einer ungewöhnlichen Kraftwirkung des Heiligen Geistes begleitet. Dazu ein bewegendes Zeugnis:
„Zu einem der Gottesdienste beabsichtigte ein Mann namens Slavik Ivan Juzefovic, ein ehemaliger Offizier, Voronaev umzubringen. Der Grund: Seine Frau hatte sich in einer der Gottesdienste bekehrt und den christlichen Glauben angenommen. Schwer bewaffnet betritt er mit zwei seiner Begleiter das Gotteshaus. Zu seinem Erstaunen sah er aber nicht, wie erwartet, Ivan Voronaev, sondern einen Engel vorne an der Kanzel stehen. Unfähig durch die Erscheinung etwas zu tun, verfolgte er den weiteren Verlauf. Plötzlich wurde eine Frau im Heiligen Geist erfüllt und offenbarte Juzefovic alle seine Sünden, die nur er kannte in seiner tschechischen Muttersprache. Tief getroffen von dem Ereignis, bekehrte er sich in diesem Gottesdienst.“
Solche gesegneten Gottesdienste und die außergewöhnliche Wirkung des Heiligen Geistes waren in erster Linie der Grund, warum so stark die Gemeinde- und Mitgliederzahl anwuchsen. Es war Gottes Wille und seine Vorhersehung, dass dieses gewaltige Werk in der Sowjetunion ausgeführt wird. Ohne seinen Beistand hätten Männer wie Kaltowitsch und Voronaev nicht im Geringsten etwas ausrichten können.
Was die menschliche Vorgehensweise betrifft, so setzten die leitenden Brüder direkt den Schwerpunkt auf Evangelisation. So wurden für dieses Werk Vollzeit-Evangelisten eingesetzt, die sich nur darauf konzentrierten, Seelen zu Jesus zu führen und neue Gemeinden zu gründen. Immerhin gab es 1927 schon 25 Vollzeit-Evangelisten und 42 Personen, die sich in Vorbereitung auf den Vollzeitdienst befanden.
Ein anderer wesentlicher Faktor war die gut durchdachte und straffe Organisation. Vom eigenen Verlag bis hin zu den Finanzen, Statistiken und dem juristischen Teil fehlte kein Bereich, der nicht gründlich organisiert und überwacht wurde. So konnte auf dieser Grundlage das Werk stetig wachsen.
Die Erweckung in der Ukraine fand jedoch 1930 mit wachsendem Einfluss des Kommunismus ihr jähes Ende. Die meisten führenden Leiter der damaligen Pfingstbewegung wurden auf Grund der „antisowjetischen Tätigkeit“ verhaftet und für mehrere Jahre in Gefängnissen oder Straflager deponiert. Für Voronaev endete der Lauf seines Lebens am 05.11.1937 durch Erschießung.
Wenn wir etwas aus seinem Leben lernen können, dann ist es folgendes:
„Erwarte Großes von Gott und tue Großes für Ihn.“
Oft versuchen wir, Gott unseren Vorstellungen anzupassen und verlieren Ihn dabei oft aus den Augen. Wir vergessen, dass wir mit unserem Gott über Mauern springen können. (vgl. Ps. 18,29)
Vielleicht erlebst du als Gruppenleiter Woche für Woche, wie wenige zu den Gruppenstunden kommen und stellst dir die Frage, wie viel Sinn es macht, so viel Aufwand in ein Thema zu investieren. Möglicherweise bist du Jungscharleiter und erlebst es andauernd, dass dir eigentlich keiner zuhören möchte, während du das Wort Gottes predigst.
Was es auch sein mag und egal in welcher Situation du in deinem Dienst oder persönlich bist, Gott hat die Macht es zu verändern. Für Ihn ist nichts unmöglich. Erwarte Großes von Gott und tue Großes für Ihn.
Lektion Nr. 2: Festhalten an der wahren Lehre
„Möge man uns alle in den Norden verlegen oder wieder ins Gefängnis stecken. Es ist uns egal, aber wohin wir auch gehen, wir werden unsere Überzeugung nicht aufgeben.“ – Gubanov
Dieses Zitat spiegelt die Einstellung der damaligen leitenden Brüder der Pfingstbewegung wider. Nichts konnte ihre Meinung ändern. Weder die Aussicht auf eine langjährige Haftstrafe, noch kluge Kompromisse in der Lehre oder persönliche Enteignungen. Sie waren überzeugt von der Richtigkeit der Lehre und standen fest wie ein Fels in der Brandung.
Schon im Jahr 1945 unternahm die sowjetische Regierung den Versuch, alle freikirchlichen Bewegungen zu zentralisieren und zu kontrollieren. So wurden die Leiter jeder Bewegung nach Moskau zitiert, um eine Einigung zu finden. In dem sogenannten „Augustabkommen“ wurden zwölf Punkte formuliert, auf die man sich einigte. Drei der zwölf Punkte waren zum klaren Nachteil der Pfingstler. So einigte man sich zum Beispiel darauf, dass
- das Empfangen des Heiligen Geistes ohne Zungenrede möglich ist
- die Zungenrede nur eine Gabe des Heiligen Geistes ist, die wenige besitzen
- das Beten in Zungen während dem Gottesdienst verboten ist
Warum dem Abkommen zugestimmt wurde, lässt sich im Detail nicht ganz aufklären. Klar ist nur, dass es selbst unter den leitenden Brüdern große Uneinigkeiten gab, ob man dem Bündnis beitreten sollte oder nicht.
Auf lange Sicht waren diese Nachteile jedoch nicht hinnehmbar und man organisierte 1948 ein Treffen in Dneprozerzinsk, um sich über den Umgang mit diesem Abkommen zu beraten.
In der Runde der 19 Personen waren Bidasch, Levtschuk und Belych, die sich von Anfang an gegen einen Beitritt ausgesprochen hatten, anwesend.
Bidasch war ein Schüler Voronaevs der ersten Stunde und führte die damalige Pfingstbewegung als erster Bischof durch diese schwierigen Jahre hindurch.
Levtschuk erlebte seit er sechs Jahre alt war, Verfolgungen auf Grund seines Glaubens und entkam im Zweiten Weltkrieg nur knapp dem Tod, weil er den Waffendienst verweigerte.
Belych dagegen kam erst während des Krieges zum Glauben und leistete einen sehr gesegneten Dienst als Evangelist in der Ukraine.
Während des Treffens einigte man sich auf folgende drei Punkte:
- Alle Leiter der Pfingstbewegung sollen in ihrer Funktion wiederhergestellt werden.
- In den Gebieten mit überragender Mehrheit von Pfingstlern sollen auch Pfingstler als Älteste eingesegnet werden.
- Im Vorstand des Allunionsrates soll ein Mitglied der Pfingstbewegung eingeführt werden.
Doch zu dieser Umsetzung der Punkte kam es nie. Unter den 19 Brüdern, gab es einen Ältesten und zugleich auch KGB-Agent, der den Geheimdienst über dieses Treffen informierte. Alle Teilnehmer wurden zu insgesamt 153 Jahren Haft in verschiedenen Gefangenenlager verurteilt.
Nach ihrer Freilassung arbeiteten sie wieder fieberhaft an einer Pfingstunion, die offiziell anerkannt werden sollte. Aus diesem Grund trafen sie sich wiederholt im Jahr 1956. Dieses Mal in Charkow. Doch auch diese Zusammenkunft blieb nicht ohne Folgen. Ein zweites Mal gingen alle führenden Brüder ins Gefängnis und spätestens ab diesem Zeitpunkt 100.000 Pfingstler in den Untergrund.
Was die Brüder und Schwester von damals ausgezeichnet hat, war eine grundlegende Einstellung:
„Wir halten an unserer überlieferten Lehre fest. Egal, was auf uns zukommt.“
Sind wir heute bereit, auf Grund der Überzeugung theologischer Erkenntnisse gerade zu stehen und schwere persönliche Nachteile hinzunehmen? Sind wir in der Lage, unsere Überzeugungen anhand des Wortes Gottes nicht nur Ungläubigen, sondern auch Menschen aus anderen Glaubensrichtungen zu begründen?
Wie sehr schätzen wir es, dass Menschen vor unserer Zeit alles aufgaben, nur um diese Lehre zu bewahren und zu verteidigen?
Fragen über Fragen. Ich hoffe, dass gerade diese Wahrheit uns alle zum ernsten Nachdenken und zur gründlichen Selbstüberprüfung in diesem Bereich anregt.
Lektion Nr. 3: Geduldig leiden für Christus
In einem Gefangenenlager im hohen Norden werden 13 Brüder bei -50 Grad mit kaltem Wasser übergossen. Während diesem Vorgang ergreift einer der Männer das Wort und spricht klar und bestimmt:
„Fürchtet euch nicht, Brüder! Gott wird uns nicht verlassen, damit ihr überzeugt werdet, wer stärker ist. Niemand von uns wird auch nur husten!“
Der Wortführer trägt den Namen Ivan Antonovich Levtschuk. Die zwölf anderen Personen waren ehemals hoch studierte Atheisten, die den Auftrag bekommen hatten, Levtschuk im Gefängnis von seinem Glauben abzubringen. Stattdessen aber, bekehrten sie sich innerhalb weniger Tage und wurden zudem mit dem Heiligen Geist getauft.
Der Mann, den der KGB als „besonders gefährlichen Wiederholungstäter“ einstufte, kommt ursprünglich aus Wolyn, Ukraine. Mit fünf Jahren kam er zum Glauben an Gott und äußerte mit sechs den Wunsch, ein Gefangener Christi zu werden. Zu dem Zeitpunkt wusste er mit Sicherheit nicht, wie wahr der Wunsch in seinem Leben werden würde.
Immer wieder zog es den jungen Levtschuk in die Gemeinschaft mit Gott, was seine Mutter überhaupt nicht leiden konnte und ihn dafür regelrecht verprügelte.
Während eines Gottesdienstes erzählte Levtschuk ein bewegendes Zeugnis, woraufhin einige vor der Gemeinde Buße taten. Er konnte sein Zeugnis kaum beenden, da stürmte seine Mutter in das Gotteshaus und zerrte ihn nach Hause. Blutig geschlagen verbüßte er seine Strafe in einer abgeschlossenen Kammer. Als seine Großmutter das dauernde Weinen hörte und ihn aus Mitleid heraus ließ, rannte er sofort wieder in den Gottesdienst und zeugte weiter von Jesus Christus.
Die anfängliche Verfolgung aus den Reihen der Familie prägten Levtschuk schon früh sehr stark. So verwundert es einen nicht, dass er bereits mit 14 Jahren Jugendleiter wurde und mit 16 wesentlich zur Gründung neuer Gemeinden beitrug.
Die Leiden für Christus prägten ihn sein ganzes Leben lang. So wurde er während eines Gefängnisaufenthalts in eine dunkle Zelle gesteckt, in welcher sich seltene afrikanische Fliegen aufhielten. Sie besaßen die Eigenschaft, sich auf die Wunden der Gefangen zu setzen und diese regelrecht zu zerfressen. Da die Fliegen sich innerhalb kürzester Zeit unvorstellbar vermehrten, gab es wenig bis gar keine Überlebenschancen für die Gefangenen.
Ein anderes Mal wurde er in einen Raum mit Tuberkulosekranken verlegt. In dieser Kammer gab es aber nur einen Becher und einen Eimer mit Wasser. Jeder musste aus diesem Becher trinken, um nicht zu verdursten. Auch Levtschuk blieb keine Wahl.
Die vielleicht härteste Folterung, die er erlebte, ereignete sich nach einem Verhör. Als der Geheimdienst merkte, dass er sich durch nichts und wieder nichts von seinem Glauben abbringen ließ, schlugen sie wutentbrannt seinen Kopf an das Mauerwerk des Gefängnisses. Das taten sie nicht nur einmal, sondern so lange, bis Levtschuk nahezu bewusstlos wurde. Als er schon regungslos am Boden lag, hofften sie, dass er durch die Folterung eine geistige Behinderung erlitt.
Aber nichts von dem passierte. Weder die afrikanischen Fliegen zerfraßen ihn, noch mit der Tuberkulose steckte er sich an. Selbst die schwerwiegenden Kopfverletzungen heilte Gott auf wundersame Art und Weise.
Levtschuk ist nur ein Beispiel von vielen, die für ihren Herrn Jesus Christus unvorstellbare Leiden durchmachten, nur um am Ende vor ihm treu erfunden zu werden.
Wie steht es heute mit uns?
Leiden für den Glauben in dieser Form ist uns weitestgehend unbekannt. Die meisten von uns sind in Deutschland aufgewachsen und komfortable Lebensumstände gewohnt. Meist wird man für seine christlichen Wertvorstellungen und Prinzipien von Arbeitskollegen und Schulkameraden respektiert. Hier und dort hat man Witze oder merkwürdige Bemerkungen auf Grund des Glaubens zu ertragen, aber weit darüber hinaus geht es oft nicht.
Das Wort Gottes spricht jedoch davon, dass „alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.“ (2.Tim. 3,12)
Die Zeit, die wir erleben, wird mit Sicherheit nicht immer so wunderbar für die Gemeinde Gottes bleiben. Deshalb gilt es, die gute Zeit zu schätzen und das Öl zu sammeln, für eine Periode der Verfolgung, wie sie die Glaubensvorbilder vor uns erleben mussten.
Möge der Herr uns helfen, Ihm allezeit treu zu sein. Auf grünen Auen und in tiefen Tälern. In Zeiten des Wohlstandes und der Knappheit. In Freiheit und in Verfolgung.