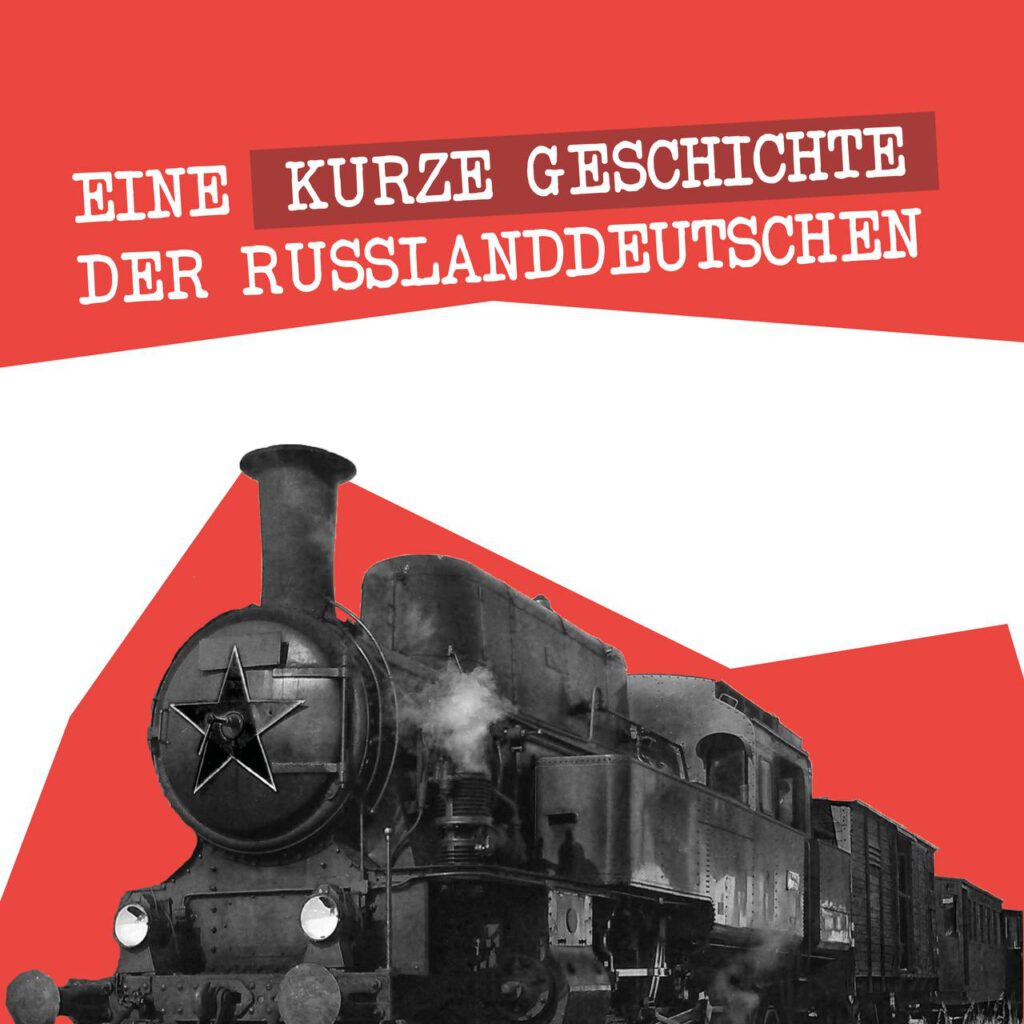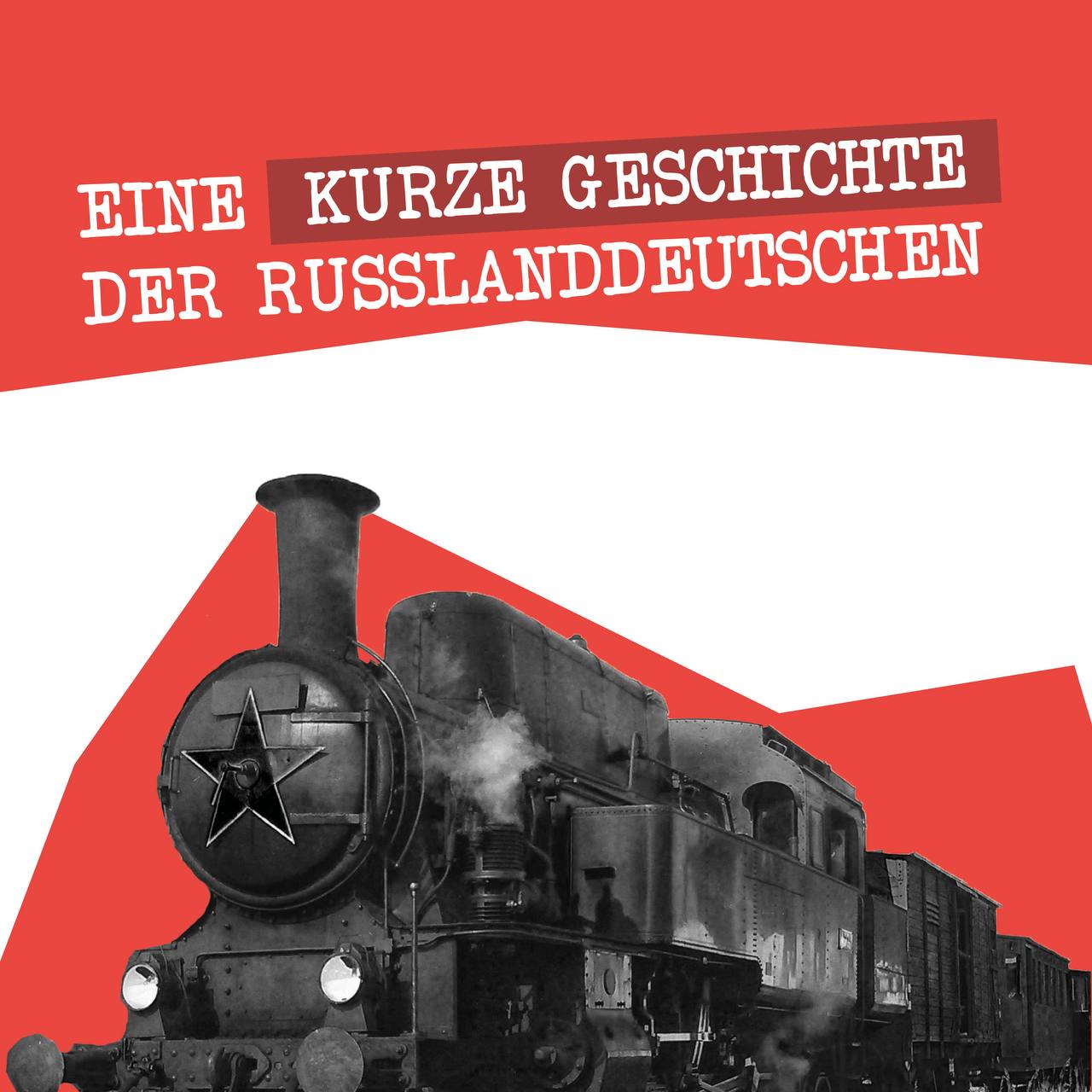Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Die Frage nach der eigenen Identität und Herkunft ist eine menschliche: Ein Volk, das seine Wurzeln nicht kennt, wird nicht lange als solches existieren – es verschwindet in die Irrelevanz. Was macht nun Russlanddeutsche aus? Warum verließen sie überhaupt ihr historisches Heimatland, nur um Jahrhunderte später wieder zurückzukehren? Was kann man daher über die heutigen russlanddeutschen Spätaussiedler schlussfolgern?
Anfänge
Durch die unendlich erscheinende flächenmäßige Größe Russlands hat es schon immer einen starken Bedarf an Fachkräften für die Armee und Wirtschaft gegeben. Somit waren fähige und tüchtige Einsiedler aus dem europäischen Ausland eine willkommene Gruppe. Während der Periode vom 13. Jahrhundert bis Mitte des 18. Jahrhunderts siedelten sich allmählich deutsche Gemeinden in Handels- und Staatsmetropolen Russlands und des Baltikums an. Zu dieser Zeit konnte man aber noch nicht von einer organisierten Auswanderung der Deutschen sprechen. Dies sollte sich aber rasch ändern.
Der Wind der Geschichte dreht sich
Im Jahr 1760 nannte der badische Staatswissenschaftler Justi drei Hauptgründe für die wachsende Bereitschaft der Deutschen ihre bisherige Heimat zu verlassen: Erstens gäbe es, zuallererst und als gewichtiger Grund, eine üble Beschaffenheit der deutschen heimischen Regierung. Zweitens einen Mangel an Gewissensfreiheit, und drittens sei ein weiterer Grund für die Auswanderungen ein Mangel an Nahrung im Lande.
Zudem unterbreitete die russische Zarin Katharina die Zweite am 22. Juli 1763 den Deutschen ein Angebot, das geradezu wie gerufen kam. Darin versprach man potentiellen deutschen Einwanderern einen ganzen Blumenstrauß an herrlichen Vorteilen gegenüber ihrer aktuellen Lebensverfassung: Glaubensfreiheit, Autonomie, 30 Jahre Steuerfreiheit, Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs, Befreiung vom Militärdienst und, als wäre alles Genannte nicht schon genug, auch noch einen günstigen Landerwerb.
Die Einladung Katharinas führte zu einer ersten großen Einwanderungswelle und Ansiedlung vieler Deutscher im sogenannten „Wolgagebiet“ nahe der Stadt Saratow.
Etwa 41 Jahre später, im Februar 1804, lud der nun regierende Zar Alexander der Erste noch einmal nach Russland ein, doch diesmal ins Schwarzmeergebiet. Von 1816 bis 1861 wanderten viele Deutsche als Antwort darauf aus Westpreußen, dem Rheinland, der Pfalz und dem Schwabenland nach Wolhynien und in den Kaukasus aus. Im Prinzip kann man sich vier große Siedlungsgebiete vorstellen, in denen deutsche Einwanderer sich niederließen:
- das Wolhyniengebiet (nahe den Städten Lemberg und Schitomir, der heutigen Ukraine entsprechend),
- das Wolgagebiet (nahe der Stadt Saratow und Woronesh, im heutigen Russland),-
- das Schwarzmeergebiet (in der heutigen Südukraine mit den Städten Odessa, Cherson, der Krim sowie Rostov am Don)
- und das Kaukasusgebiet nahe der Stadt Tiflis.
Es dauerte nicht lange bis sich die deutschen Einwanderer als eine der wachstumsstärksten Bevölkerungsgruppen Russlands erwiesen. Was zeichnete sie aus? Es waren Faktoren wie wirtschaftlicher Erfolg, Bildung und ein intensives Glaubensleben. Es kam nun zu einer sogenannten Periode des Höchststandes, der aber schnell eine gegensätzliche Entwicklung folgte. Dies nahm etwa Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang: Die Deutschen in Russland wurden innerhalb kurzer Zeit von einer Gruppe Privilegierter zu einer Gruppe Diskriminierter.
Aus Wind wird Unwetter
Bereits im Jahr 1842 stellte man die staatliche Förderung für Siedler ein. Diese Förderung hatte anfangs viele Einwanderer positiv gestimmt. Einige Jahre später, im Juni 1871, begann ein systematischer Prozess der Russifizierung und der Aufhebung von Privilegien. Er war Ausdruck einer Bewegung gegen die Ausbreitung des Deutschtums in Russland.. Dies führte wenige Zeit später im Jahr 1874 zu mehreren großen Auswanderungswellen von Russlanddeutschen aus dem Russischen Reich: Von 1874 bis 1883 wanderten tausende Mennoniten nach Kanada und in die USA aus. Um 1887 emigrieren Wolgadeutsche nach Argentinien und in andere Gegenden Südamerikas. Allein innerhalb der Jahre 1901 bis 1911 wanderten etwa 105.000 Russlanddeutsche nach Amerika aus.
Und nun mehr Konkretes im Kontext: 1874 führte man die unter vielen Bibeltreuen abgelehnte Wehrpflicht auch für Russlanddeutsche wieder ein. 1887 heißt es in einem Manifest Alexanders III.: „Russland muss den Russen gehören“, und 1891 wird Russisch zum Pflichtfach an deutschen Schulen.
Aus Unwetter wird Sturm
Damit nicht genug, sollte sich mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 und durch den Zweiten Weltkrieg alles schlagartig in eine katastrophale Richtung ändern.
Hier einige historische Daten, die bei der Einordnung helfen sollen: 1915 wird die deutsche Sprache verboten, etwa 200.000 Wolhyniendeutsche nach Sibirien deportiert und Pogrome gegen Deutsche in Moskau initiiert.
Allein im Jahr 1921 verhungern etwa 120.000 Deutsche. In der Zeitperiode von 1914 bis 1928 reduziert sich die Gesamtzahl der Russlanddeutschen in Russland von etwa 2,4 Millionen auf etwa 1,2 Millionen Menschen.
Überschattet von all diesen Ereignissen sind aber auch Entwicklungen, die die allgemeine Bevölkerung betreffen: Um das Jahr 1928 wird seitens der Sowjetregierung die sogenannte Zwangskollektivierung eingeführt. Somit wurde praktisch alles Privateigentum verstaatlicht und vor allem Bauern dazu gezwungen, sich großen Arbeitsgemeinschaften anzuschließen.
Der Protest der Bauern dagegen zeigte sich beispielsweise darin, dass man das eigene Vieh schlachtete, bevor es in staatliche Hände fallen konnte. Trotz der dadurch sinkenden Produktionsleistungen exportierte man große Mengen Lebensmittel auf dem Weltmarkt. So gewann man Einnahmen, um die Industrialisierung Russlands voranzutreiben. Diese Politik mündete schließlich in einer verheerenden Hungersnot, dem ‚Holodomor‘ (1932/33). Vorwürfe gegen die Sowjetregierung bestanden darin, dass diese Maßnahmen absichtlich durchgeführt und Menschen bewusst der Zugang zu Lebensmitteln verwehrt wurde. 1933 verhungerten etwa 350.000 Deutsche. Allein in der Ukraine wurden 1937/38 122.237 Deutsche zum Tode und 72.783 zu Haftstrafen von meist 10 bis 25 Jahren verurteilt.
Viele Enkel – vielleicht auch einige Leser dieser Zeilen – erinnern sich an die Erzählungen ihrer Großeltern. Es geht um groß angelegte Deportationsaktionen, die mit enormem Aufwand durchgeführt wurden. Diese fanden zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Richtung Nordrussland, dem fernsten östlichen Sibirien und in Gebieten Südrusslands, wie Kasachstan und Kirgisien statt. Eine davon am 28. August 1941, in welcher allein etwa 1,5 Millionen Deutsche nach Sibirien deportiert wurden. Unzählige Deportierte wurden als entrechtete Arbeitssklaven der sogenannten ‚Trudarmee‘ in Arbeitslager geschickt. Dort standen sie unter einer speziellen Sonderverwaltung. Am 26. November 1948 wird festgehalten, dass die Verbannung aus dem ehemaligen Siedlungsgebieten für ewige Zeiten festgeschrieben wird. Unerlaubtes Verlassen der Sondersiedlungen durch die Zwangsumgesiedelten wurden mit bis zu 20 Jahren Haft geahndet.
Der Sturm legt sich
Mit der 1955 aufgehobenen Sonderverwaltung und dem 1972 aufgehobenen Rückkehrverbot in ehemalige Siedlungsgebiete kommt schließlich neue Hoffnung auf. Dadurch kehrten viele Russlanddeutsche wieder in ihre ehemaligen Siedlungsgebiete in der Südukraine, dem Schwarzmeergebiet und in den Kaukasus. Als die Sowjetunion 1989 schließlich aufgelöst wird und der Eiserne Vorhang endgültig fällt, ist der Dammbruch unaufhaltsam. Allein in den Jahren 1989 bis 1999 emigrieren jährlich etwa 100.000 Spätaussiedler aus der ehemaligen UdSSR. Viele von ihnen kehrten zurück nach Deutschland, viele in andere Länder des Westens.
Aussichten
Diese Zeit war für die Gemeinde Christi, unabhängig von Nationalität und Ethnie, eine Zeit der harten Prüfung und Läuterung. Was die Nachfahren dieser um ihres Glaubens willen Verfolgten heute (hoffentlich) in ihren Händen halten, ist das Ergebnis dieser Läuterung: Sind wir bereit, den Preis des Gezahlten hoch genug zu schätzen? Oder spielen wir leichtsinnig mit ihm, wie mit einem Kronjuwelen an der Reling eines Kreuzfahrtschiffes?