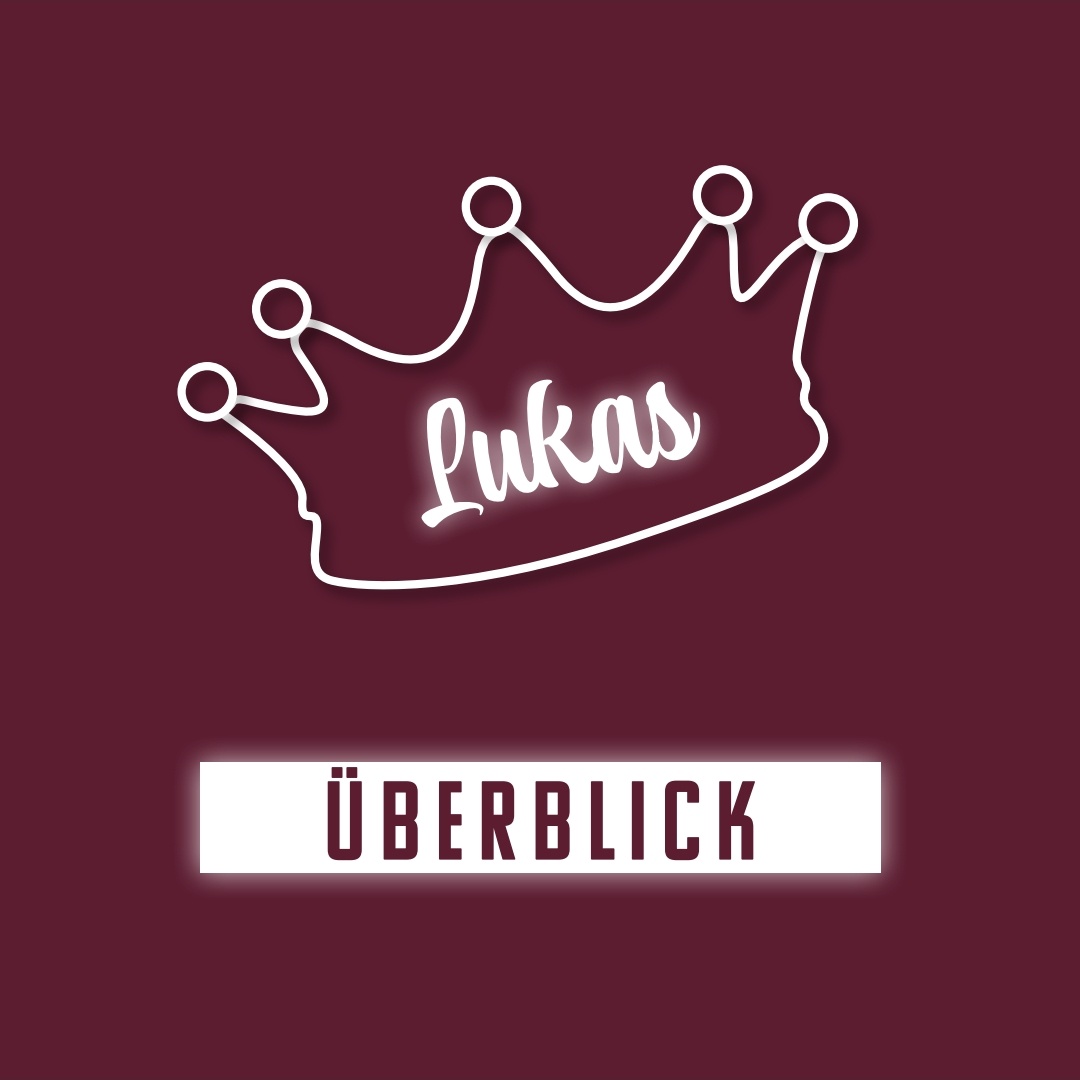Mit dem Lukas-Evangelium ist das dritte der sogenannten synoptischen Evangelien Thema im Jugendkompass. Und wirklich: Es ist die Krone der synoptischen Evangelien.
Randnotiz: Synoptische Evangelien sind die ersten drei Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas. Das Wort synoptisch kann man ungefähr als „zusammenschauen, übereinander gelegt betrachten“ verstehen. Diese drei Evangelien ergänzen sich: Sie enthalten zu einem großen Teil Zeugnisse derselben Ereignisse, nur von verschiedenen Seiten her betrachtet. Man kann also aus den drei Evangelien ein einziges großes schreiben – das wäre dann quasi das synoptische Evangelium, das aus der Zusammenschau von Matthäus, Markus und Lukas entsteht. Mit Johannes funktioniert das nicht: Dazu vielleicht mehr, wenn Johannes an der Reihe ist.
Die Krone wird es genannt, weil es uns Details berichtet, die bekannten Ereignissen die Krone aufsetzen: So berichten alle Evangelien von der Versuchung Jesu, aber nur Lukas erwähnt, dass der Teufel eine Zeitlang von ihm wich. Alle schildern das Leiden in Gethsemane, doch in Lukas finden wir die Schweißtropfen, die wie Blut wurden. Auch der Engel, der Jesus in Gethsemane stärkt, findet sich in Lukas. Auch von der Reue des Petrus vor dem auferstandenen Jesus wird berichtet – doch der Blick des Herrn wird nur in Lukas geschildert.
Wer war Lukas?
Wie Markus ein Mitarbeiter des Petrus so ist Lukas ein Mitarbeiter des Apostel Paulus gewesen. In Kol. 4,14 und Phlm. 24 erfahren wir außerdem, dass er ein Heidenchrist war. Alte kirchliche Quellen (nur wenige Jahrzehnte nach dem Tode der Apostel) erwähnen, dass er aus Antiochien stammte. Das steht zwar nicht direkt in der Bibel, ist aber sehr wahrscheinlich. Demnach war er ein antiochenischer Syrer, der auch nach Paulus Tod noch dem Herrn als Diener des Wortes diente und im Alter von 84 Jahren in Theben, der Hauptstadt Böotiens (das in Griechenland liegt), starb.
Über seine Bekehrung wissen wir nichts Genaues – doch als Paulus von Troas aus nach Mazedonien aufbricht (Apg. 16,10) war Lukas dabei. Hier wechselt nämlich die Sprache der Apostelgeschichte in die Wir-Form: Der Erzähler war selbst dabei. In Philippi trennen sich die Wege, da Lukas als Stütze der jungen Gemeinde zurückbleibt. Schon damals war er ein Evangelist: Die ersten Gemeinden zur Zeit der Apostel unterschieden nämlich einerseits zwischen Dienern, die im Missionswerk bzw. bei der Verkündigung tätig waren – das waren vor allem die Apostel. Andererseits gab es noch den Dienst des Evangelisten, wie zum Beispiel Markus und Lukas welche waren: diese waren nicht etwa Missionare, wie wir das Wort heute verstehen. Sie waren dafür zuständig, in den noch frischen und manchmal instabilen, nicht verwurzelten Gemeinden das Evangelium von Jesus Christus und die Lehre der Apostel zu festigen. Sie schärften den Neubekehrten immer und immer wieder die Worte und Taten Christi ein. Kein Wunder, dass sie auch später von der Gemeinde dazu bestimmt wurden, diese Worte und Taten niederzuschreiben: denn das war ihr Hauptberuf, ihr täglich Brot! Damit kannten sie sich richtig gut aus. Der Evangelist Lukas blieb also in Philippi, um die Gemeinde zu stärken und aufzubauen. Als Paulus wieder in Philippi vorbeikommt (Apg. 20,5), wechselt die Apostelgeschichte wieder in die Wir-Form: Lukas ist wieder mit Paulus dabei! Auch als Paulus nach Rom in die Gefangenschaft geht, sind Lukas und ein anderer Bruder namens Aristarchus mit von der Partie (Apg. 27,1). Lukas wird gar als Letzter erwähnt, der noch bei Paulus ist – er war wohl bis zum Schluss an seiner Seite. In den Briefen, die Paulus aus der Gefangenschaft in Rom schreibt (eben Kolosser und Philemon), grüßt er stets auch von Lukas. Diese sehr enge Freundschaft mit Paulus, die Verbundenheit mit dem Missionswerk, und die tägliche Arbeit als Evangelist – all das finden wir auch in dem Evangelium von Lukas wieder.
Wer war Theophilus?
Adressiert ist es an einen gewissen Theophilus. Wer genau das war, erfahren wir wieder aus den Schriften der frühen Kirche. Eine alte Beglaubigung eines Bischofs erzählt, dass Theophilus genau wie Lukas aus Antiochien stammte. Dort soll er der angesehenste aller Bürger gewesen sein. Als Petrus dort predigte, wurde er so ergriffen, dass er eine große Halle in seinem prächtigen Haus zur Verfügung stellte, damit dort die Gottesdienste abgehalten werden konnten. Soweit die Kirchenväter. Die Bibel berichtet nur, dass er ein sehr angesehener Mann gewesen sein muss. Die Anrede, die Lukas in der Apostelgeschichte und am Beginn des Lukas-Evangeliums gebraucht („Hochansehlicher Theophilus“), wird sonst nur bei sehr hochstehenden römischen Senatoren, Fürsten und Rittern gebraucht: zum Beispiel in Apg. 23,26 und 24,3 vor dem Statthalter Felix und in 26,25 vor Festus. Theophilus muss also ein außergewöhnlich hochstehender Mann gewesen sein. Dieser Beginn des Lukas-Evangeliums bringt uns zu einer weiteren Besonderheit.
Was ist das Besondere an Lukas` Schreibstil?
Lukas und Paulus waren nicht nur geistlich und dienstlich sehr eng verbunden: Sie hatten auch eine ähnliche Bildung. Sowohl Paulus als auch Lukas waren gelehrte Männer. Und das zeigt sich gerade in Lk 1,1-4. Eine solche Anrede, ein solcher Anfang für ein Buch oder einen Bericht war in der Antike damals nämlich üblich – aber nur unter den großen, historischen Schriftstellern wie Herodot und Thukydides. Lukas verwendet den gleichen Stil wie sie. Und wie die großen „Goethes und Schillers der Antike“ ist Lukas ein Meister seines Fachs. Das griechische Lukas-Evangelium gilt als wunderschöne Literatur, die Satzmelodien und die Wortwahl machen es selbst für Ungläubige allein wegen der Kunst der Sprache zu einem wertvollen Schatz. Die Widmung an Theophilus bedeutete in der Antike übrigens nicht, dass Lukas das Werk nur für ihn geschrieben hätte. Wir finden dieses Vorgehen bei vielen großen Kunstwerken. Ein bekanntes Beispiel ist Beethovens Musikstück „Für Elise“. Auch dieses widmete er einer bestimmten Person – aber natürlich schrieb er es, damit es möglichst viele Leute spielen und hören, und nicht nur für jene Elise. So ist es auch mit dem Lukas-Evangelium. Es ist von Anfang an als Evangelium für alle angelegt. Lukas weiß: Es geht um das größte Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Um das richtig wiederzugeben, hat er die Werkzeuge der besten Schriftsteller der damaligen Zeit genutzt; dafür hat er alles rausgeholt, was an Fähigkeiten in ihm vorhanden waren. Darin ist er auch für uns ein Vorbild.
Zugleich zeigt sich die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt des Arztes in diesen vier Versen: Lukas beschreibt hier eine historisch-exakte, wissenschaftliche Vorgehensweise. Er wollte es ganz genau wissen, hat selbst nachgeforscht und ist allen Spuren nachgegangen, bis zur Quelle. Gewissenhaftigkeit und Liebe zur Wahrheit – auch das sind bis heute unerlässliche Eigenschaften für einen Diener am Worte Gottes.
Gliederung
Das Evangelium gleicht einem Reisebericht. Während andere Evangelisten zum Beispiel die Reden Jesu gesammelt an einem Ort beschreiben, und die Wunder an einem anderen, ordnet Lukas sein Evangelium nach den Etappen einer Reise an. Die Stationen sind:
Nazareth (1,1 – 4,31)
Kapernaum (4,31 – 9,51)
Jerusalem (9,51 – 19,28 – 24,53)
Die Reise nach Jerusalem von 9,51 bis 19,41 macht hierbei noch einen großen Anteil aus, ansonsten sind alle Stationen aber etwa gleich lang. Auffällig ist hierbei: An allen Stationen der Reise freuen sich die Menschen zunächst über Jesu Auftreten und sein Wirken. Nach und nach, in Nazareth nur einmal und zaghaft angedeutet, in Kapernaum heftiger, und in Jerusalem dann auf dem Höhepunkt, zeigt sich aber: Jesus, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das tief in die Seele dringt, ein Spiegel der Seele – und lässt niemanden kalt, sondern entzweit in Gegner und Nachfolger.
Inhalte
Nazareth:
Als einziger Evangelist beschreibt Lukas sowohl die Kindheit des Johannes als auch die von Jesus. Hier zeigen sich die Früchte seiner gewissenhaften Recherche und der vielen Gespräche, die er mit den Augenzeugen Christi führte, um diese Abschnitte von Gottes Geist geleitet weiterzugeben. Und es sind wundervolle Abschnitte – herrlich das Erscheinen der Engel den Hirten, wie sie Frieden auf Erden verkünden. Unvergesslich und im ganzen Christentum bekannt die Verse: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich schätzen ließe.“ Besonders ist auch das Geschlechtsregister Jesu: Das Lukas-Evangelium macht das Heil für alle Menschen und den Missionsbefehl, der allen Völkern das Heil offen stellt, schon hier deutlich. Denn Jesu Stammbaum wird nicht nur bis zu Abraham zurückgeführt, sondern bis hin zu Adam. Eine weitere Schönheit: die Lobgesänge der Maria und des Zacharias. Auch das „Nun lässest du deinen Knecht in Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heil gesehen!“ wurde vielfach von bekannten Komponisten vertont – die Schönheit der Texte ist atemberaubend und wurde auch noch 1700 Jahre später weltweit geschätzt.
Jesus wächst in der Kraft des Heiligen Geistes und in Gnade bei Gott und den Menschen auf. Nach seiner Taufe und der Versuchung in der Wüste beginnt er sein öffentliches Wirken in der Synagoge. Nach der zaghaften Andeutung bei Simeon – noch durch die Wunder der Weihnachtsnacht übertönt von Freude (2,34-35) – erfährt Jesus hier zum ersten Mal die Ablehnung seiner Worte. Wohlgemerkt: In 4,22 lesen wir noch, dass Jesus selbst und die Worte der Gnade wohl aufgenommen wurden. Doch als Jesus von seiner Mission sprach, und sogar die Heiden über Israel zu stellen scheint: da ist es mit der Geduld vorbei. Jesus deckt genau die wunden Punkte in den Herzen der Menschen auf – und viele ertragen das nicht, sondern werden zornig. Jesus bricht auf nach Kapernaum.
Doch eines wird in Nazareth trotz des schmerzlichen Widerspruchs auf wunderbare Weise deutlich: Es zeichnet ein Volk, das in Erwartung seines Heilands war. Die meisten erkannten ihn dann nicht, aber gerade in den ersten vier Kapiteln werden uns so wunderbare Vorbilder des Glaubens wie Maria, Elisabeth, Simeon und Hanna vorangestellt! Auch das Familienleben der Frommen strahlt wie ein helles Licht, wie eine Verlängerung der Weihnacht: Alle Nachbarinnen Elisabeths freuen sich, als sie erfahren, dass „der Herr seine Barmherzigkeit groß gemacht hatte an ihr“. Selbst in der Ablehnung Jesu in 4,22 gaben ihm „alle Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen“. Diese Stellen zeichnen ein wunderbares Bild von Familien und Gemeinden, die ein offenes Auge haben für die Herrlichkeit, für die Barmherzigkeit Gottes, die ihn kennen und sich an seinem Wirken freuen.
Kapernaum:
Was in Nazareth sich stille vorbereitet hatte, kommt in Kapernaum zur Entfaltung. Jesus beruft seine Jünger und trifft erstmals auf streitlustige Pharisäer. Die ersten Gleichnisse werden erzählt, die Verkündigung des Evangeliums und die Belehrung der Jünger nimmt ihren Lauf. Und Lukas, der Arzt, hält immer wieder akribisch fest: „und er heilte sie alle“. Lukas legt Wert darauf, den Prozess genauer zu beschreiben: „Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus, und heilte sie alle.“ Lukas bezeugt: Die Krankheiten verschwanden nicht einfach im Nirgendwo, sondern sie wurden überwunden von der Kraft, die in Jesus war – nach den „geistlichen Naturgesetzen“, dem Befehl des Herrn. Und auch, wo diese Kraft zu finden ist, erfahren wir: „Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten: und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott“ (6,12). Lukas bildet den ganzen „Kreislauf“ ab und stellt uns so mehr zur Verfügung als einen Bericht: Wir können lernen und erfahren, wie die geistlichen Zusammenhänge sind, die effektiven Dienst ermöglichen.
Jesu Worte werden zunehmend fordernder: Das Schwert beginnt zu schneiden. Besonders hervorheben möchte ich Lk. 7,46ff: „Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage?“ Das folgt recht unvermittelt auf eine verkürzte Version der Bergpredigt. Dort heißt es, seine Feinde zu lieben, den Mantel nicht zu verwehren und so weiter. Dass Jesus damit keine schöne Metapher gemeint hat, sondern es ernst ist, zeigt der zitierte Vers.
Jerusalem:
Nachdem Jesus seine Jünger (nun Apostel genannt) mit Vollmacht ausstattet, und das ganze Volk über die gewaltige Kraft Gottes erstaunt, folgen nun die Ankündigungen der Leiden. Während der Reise nach Jerusalem (Kp. 11) finden wir außerdem wichtige Prinzipien des Gebets, besonders der Beharrlichkeit. In diesem Teil finden sich viele Lehren und Gleichnisse Jesu – sie haben alle einen sehr ernsten Charakter. Die einen beschreiben ernstlich geistliche Gefahren, künden von der Verwerfung Jesu oder rufen zur Buße. Andere geben mit dem gleichen, ernsten Tonfall starke Verheißungen, etwa des Glaubens oder der Gebetserhörung.
War der erste Einzug in Jerusalem noch durchtränkt mit Freude, in ein geheimnisvolles, wunderschönes Licht getaucht durch die Weihnachtstage und die wunderbaren Glaubensvorbilder, die uns begegnen, durch die Reinheit, Unschuld und den Frieden, das Lob, die Gemeinschaft – so beginnt der zweite Einzug (19, 41) mit bitterlichem Weinen. Jesus geht seinem Leiden entgegen, doch in alledem weint er um sein geliebtes Jerusalem. Nur wenig später nach ihm wird es dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Worte „…weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast“ sind buchstäblich in Erfüllung gegangen.
Wie schwer muss es für Jesus gewesen sein! „Und er lehrte täglich im Tempel; die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen; doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten; denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu“ (19,47).
Jesus lehrt das Volk, man spürt förmlich aus diesen Zeilen den Durst des Volkes nach der reinen Lehre, nach der Liebe Gottes – und Jesus gibt es ihnen so gerne, stillt den Hunger so gerne! Während die „Bauleute, die den Eckstein verwerfen“ nur Todesgedanken hegen und Mordpläne schmieden!
Der Gegensatz zeigt stark die Majestät des Messias-Königs: Während seine Feinde seinen Tod planen, kümmert er sich lieber um die, die er liebt: sein Volk, das ihn braucht. Sie sehnen sich so nach ihm, und verlangen so sehr nach seiner Lehre, dass sie frühmorgens schon in den Tempel kommen, um ihn zu hören. Er teilt ihnen gerne und den ganzen Tag die Speise aus, in Liebe und Geduld dienend – während er weiß, dass nur wenige Schritte entfernt Menschen sich am Fall eines seiner Jünger erfreuen, das Gesetz Gottes brechen, eine Verschwörung gegen unschuldiges Blut anzetteln… doch er steht stark und tut das Werk eines Hirten königlich. Sein geliebtes Jerusalem bekommt von ihm die letzten Liebeserweise, bevor er ans Kreuz geht.
Doch er bleibt nicht dort: Die Stimme der Engel tönt gewaltig, bis heute – und die Freude der Weihnachtstage ist nicht nur wieder da, sie ist verklärt: „Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“ tönt es den Frauen entgegen – und das Herz der Emmaus-Jünger fängt an zu brennen, langsam, langsam entfachen sich die Funken – bis das Feuer des Heiligen Geistes die Welt entflammt.
Die letzten Verse beschreiben ein herzliches Wiedersehen – der Tadel Jesu über den Unglauben, er verschwimmt ja fast in der sich darin zeigenden Liebe zu seinen Jüngern, zu den Frauen die ihm nachfolgten. Die Freude der Gemeinschaft, der Auferstandene bei uns, in uns: In dem Bericht des letzten Kapitels kommen die freudigen Triebe der ersten Kapitel in voller Pracht zur himmlischen Blüte: das Weihnachtswunder, die Freude über den Messias, der sein Volk aus dem Elend erretten wird, ein Volk in Erwartung: das alles verklärt sich in der Freude des „Gott-mit-uns“, des ewigen, himmlischen Lebens, das nun jedermann offen steht. Es ist vollbracht, Amen!
Und diese Botschaft wird fortgetragen bis in die entlegensten Winkel der Erde. Selbst die dunklen Wälder Germaniens hören es, selbst so entlegene Gegenden des Reiches wie Noviomagus (Speyer) merken: Der Herr ist auferstanden!
Den Weg dorthin beschreibt Lukas dann aber in der Apostelgeschichte – vielleicht ja ein Thema für ein anderes Mal.